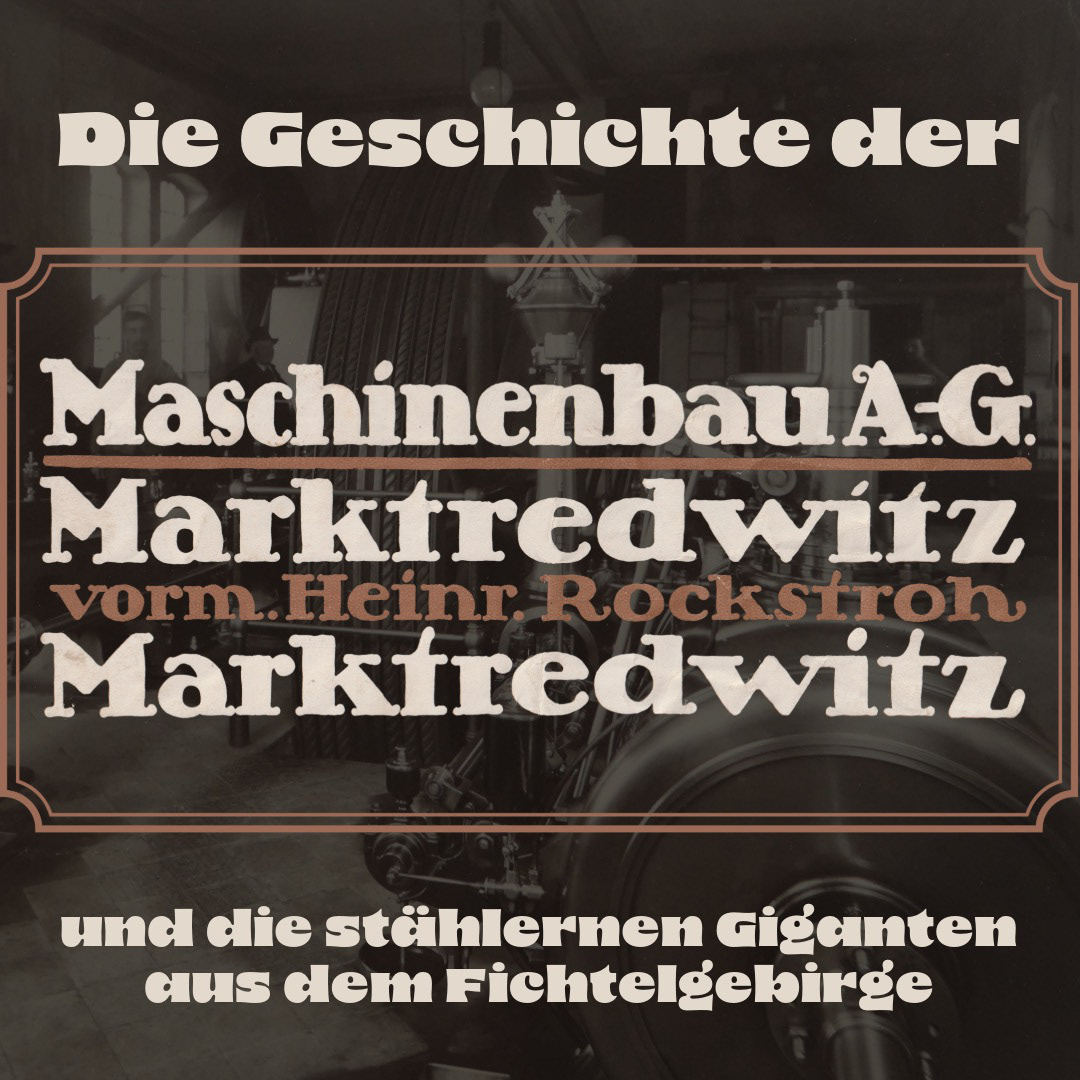Hier finden Sie eine Übersicht der nächsten Vortragstermine.
Bei Interesse können Sie sich die Einträge direkt in Ihren eigenen Kalender importieren.
Vortragsthemen
Hier finden Sie eine Übersicht aller derzeit angebotenen Vortragsthemen.
Nähere Informationen erhalten Sie durch einen Klick auf das jeweilige Bild.

Heute ist die Geschichtsforschung sich einig, was die Besiedlung unserer Region angeht und konnte nachweisen, dass, anders, als bisher gedacht, bereits in der Steinzeit erste Menschen unsere Heimat wenigstens durchzogen. Anhand archäologischer Funde wird im Vortrag der Versuch unternommen, die Geschichte des Fichtelgebirges in vorchristlicher Zeit bis hin zum Frühen Mittelalter zu rekonstruieren.

Als im Jahre 1523 ein 12.000 Mann starkes Heer die Burgen unter anderem der Herren von Sparneck und der Herren von Guttenberg zerstörte, endete damit ein Kampf zwischen zwei Epochen: Jahre vorher hatte sich das mittelalterliche Ständewesen ein letztes Mal gegen die neuzeitliche Macht des Kapitals erhoben und schließlich verloren. Unter Führung der Stadt Nürnberg wurden daraufhin alle Kleinadligen unter dem Vorwurf der „Plackerei“ verfehmt, ehe sie schließlich im Rahmen des romantischen Raubrittertums gar einer damnatio memoriae verfielen.

Bis heute gilt die Region zwischen Bayreuth und Hof als „Textildreieck“, wobei man sich meist auf die blühende Industrie des 20. Jahrhunderts bezieht. Die Tradition der Weberei reicht jedoch sehr viel weiter zurück, als man annehmen würde. Schon im Mittelalter konzentrierte man sich neben der Landwirtschaft auf ein meist im Winter betriebenes Gewerbe. Ausgehend von dieser Subsistenzwirtschaft entwickelte sich im 18. Jahrhundert ein erstes Verlagswesen, das unter Förderung des Ministers Hardenberg schließlich zu den ersten Manufakturen und Fabriken führte.
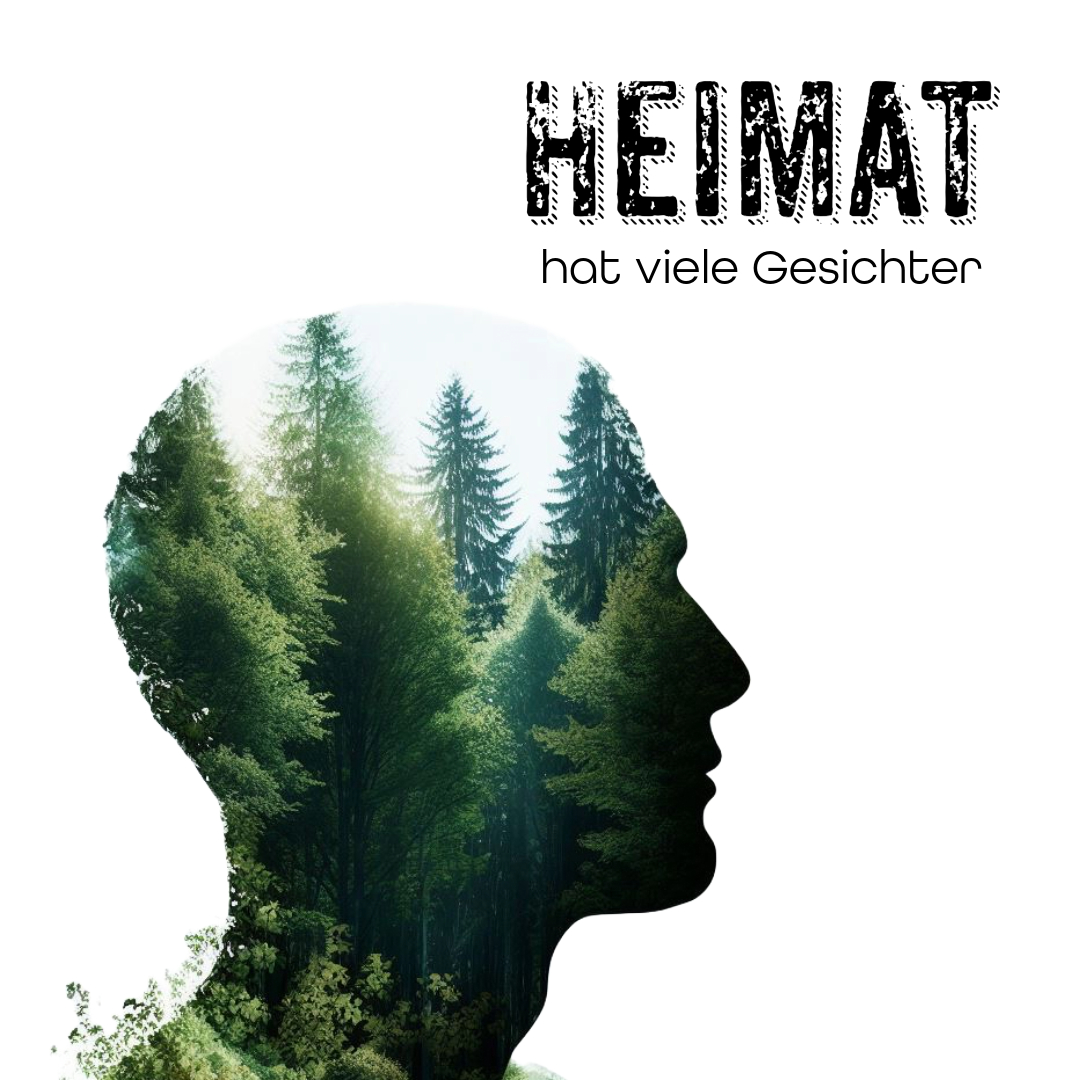
Dieser Vortrag versucht, die großen Entwicklungslinien der Landesgeschichte nachzuzeichnen: Von der ersten Besiedlung über das Mittelalter bis ins Industriezeitalter zeigt er schlaglichtartig, welche Zusammenhänge die historische Entwicklung beeinflussen und wie genau sie zur Ausprägung der ganz typischen, bodenständigen Kultur geführt haben.
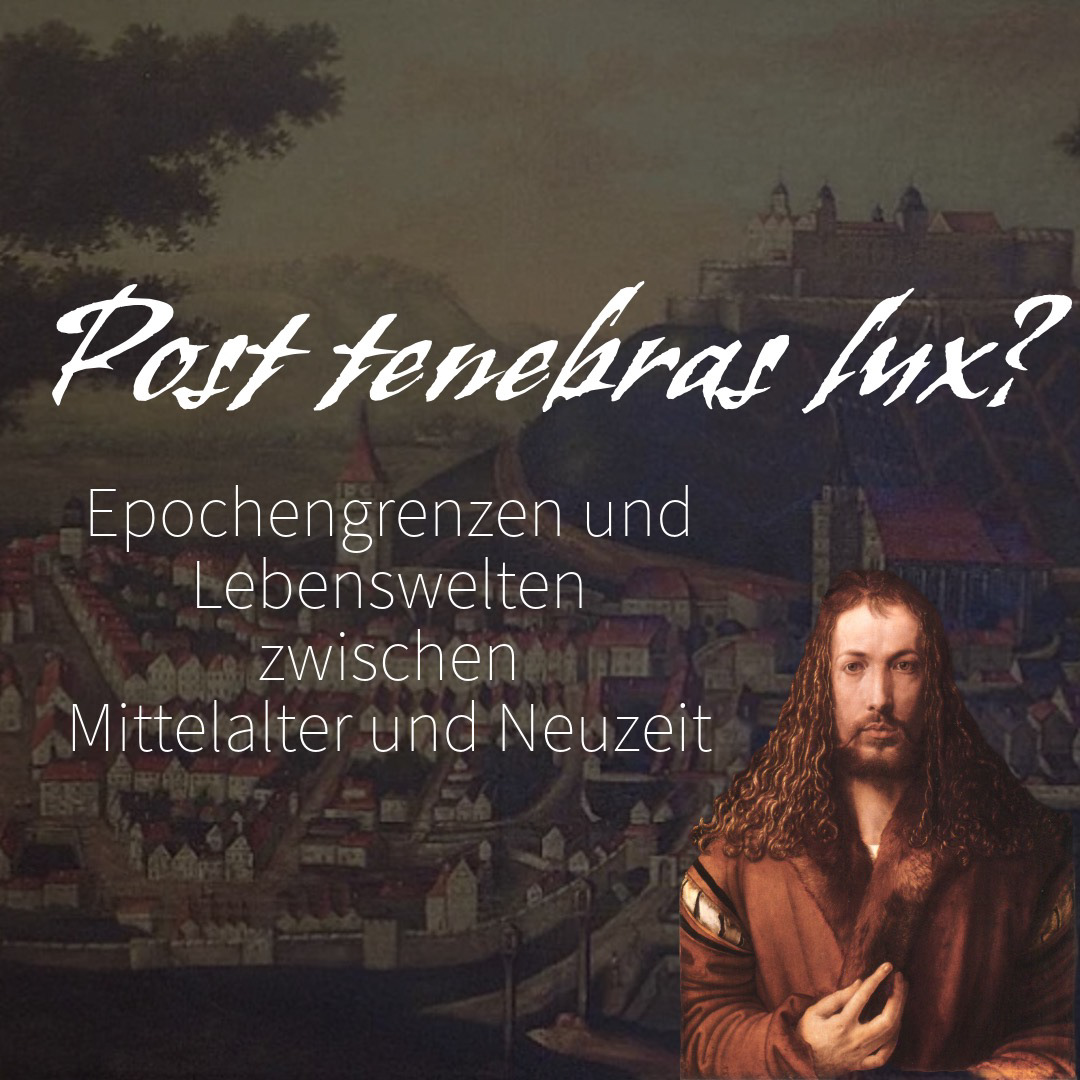
Das Mittelalter gilt als die "dunkle Epoche" zwischen der Antike und deren Neugeburt in der danach benannten Renaissance. Aber ist das wirklich so? Immerhin stellt die Epoche auch eine wichtige Grundlage für Wissenschaft und Forschen, wie auch für gesellschaftlichen Wandel dar. Der Vortrag beleuchtet die "Epochengrenze" ab 1500 und rückt dabei auch manches Vorurteil gerade.
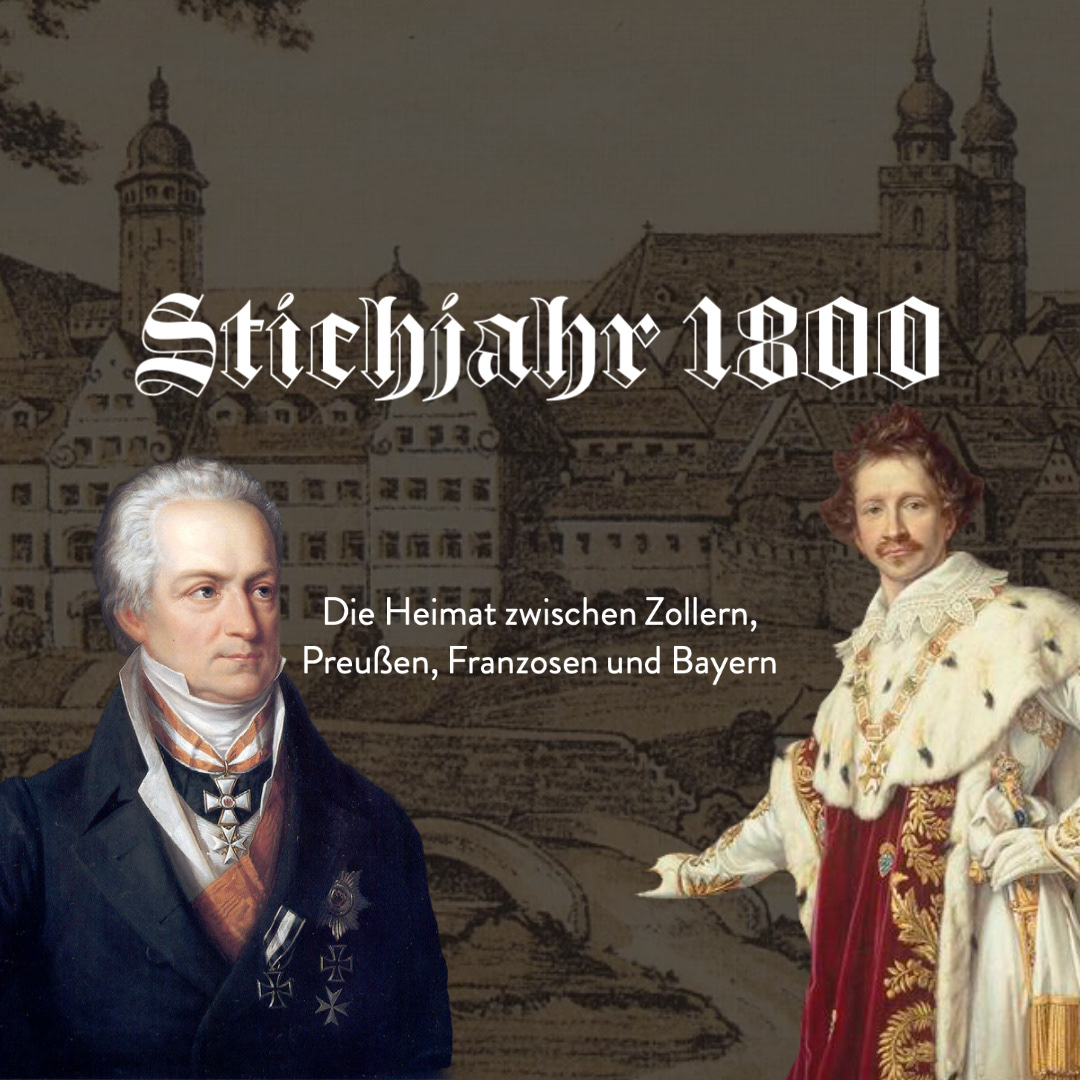
Die Zeit zwischen 1790 und 1810 gehört zu den bewegtesten der fränkischen Landesgeschichte: Nach der Abdankung des letzten Markgrafen, Karl Alexander, übernahmen die Preußen die Regierung in Bayreuth und machten unter Leitung Karl August von Hardenbergs aus dem Fürstentum den ersten europäischen Staat im modernen Sinne. Schon 1806 endete die damit einhergehende wirtschaftliche Blüte mit dem Einmarsch französischer Truppen, denen mit Provinzialverwalter Camille de Tournon ein weiterer Genius seiner Epoche folgte. Die politischen Umstürze, aber auch die wirtschaftlichen Entwicklungen stehen im Mittelpunkt des Vortrags, der zudem einen Blick auf all jene werfen wird, die oftmals vergessen werden: Auf die Menschen vor Ort, die sich mit immer neuen Strukturen und Forderungen zurecht finden mussten.

Das Fichtelgebirge ist eine unglaublich vielfältige Landschaft, was sich auch auf ihre Bewohner auswirkt: Anhand verschiedener Beispiele zeigt der Vortrag, wie sich das Leben der angeblich “kleinen Menschen”, also eben denen, die unsere Kultur bis heute nachhaltig prägen, im Laufe der Zeit geändert hat: Vom mittelalterlichen Bauern bis zum Industriearbeiter; vom Kleinadligen bis zum bürgerlichen Fabrikanten.
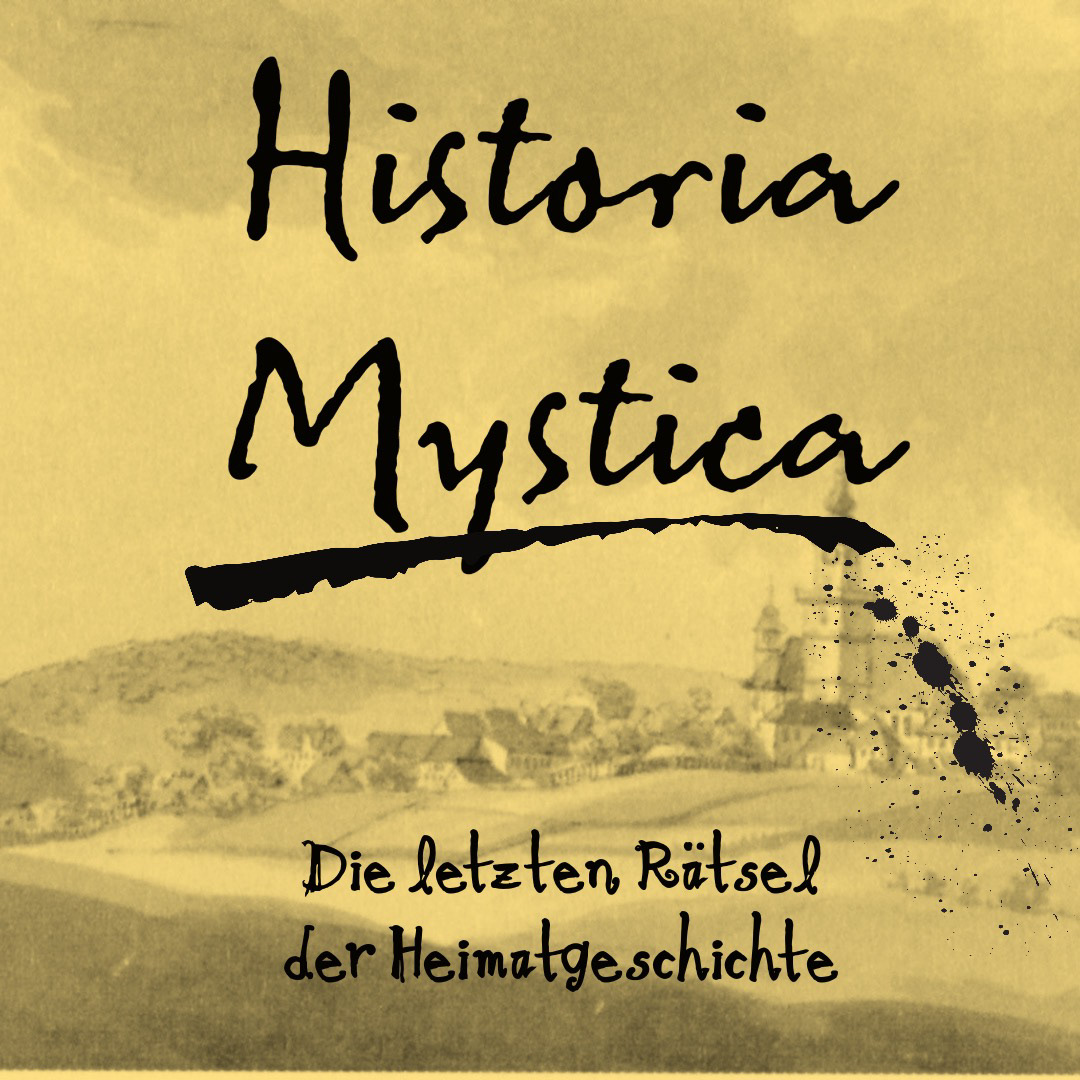
In der Heimatgeschichte gab und gibt es viele bis heute ungelöste Mythen und Rätsel, die vor allem in der Bevölkerung immer wieder für Gesprächsstoff sorgen. Im Vortrag werden die bekanntesten „Geheimnisse“ der Region beleuchtet und enträtselt, wobei Themen aus verschiedenen Jahrhunderten vorgestellt werden. Neben Windmühlen im Fichtelgebirge stehen unter anderem auch die „Wendische Wallstätte“, geheimnisvolle „Drudengräber“, „geheime Gänge“ und Steinkreuze im Mittelpunkt.

Fast niemand kennt heute mehr die alten Bräuche und Sagen unserer Vorfahren, doch üben sie noch immer eine große Anziehungskraft auf die Menschen des Fichtelgebirges aus. Im Rahmen des Vortrags soll versucht werden, die Herkunft des Volksglauben zu begründen und darüber hinaus auch einige längst vergessen Bräuche wieder in den Fokus zu rücken.
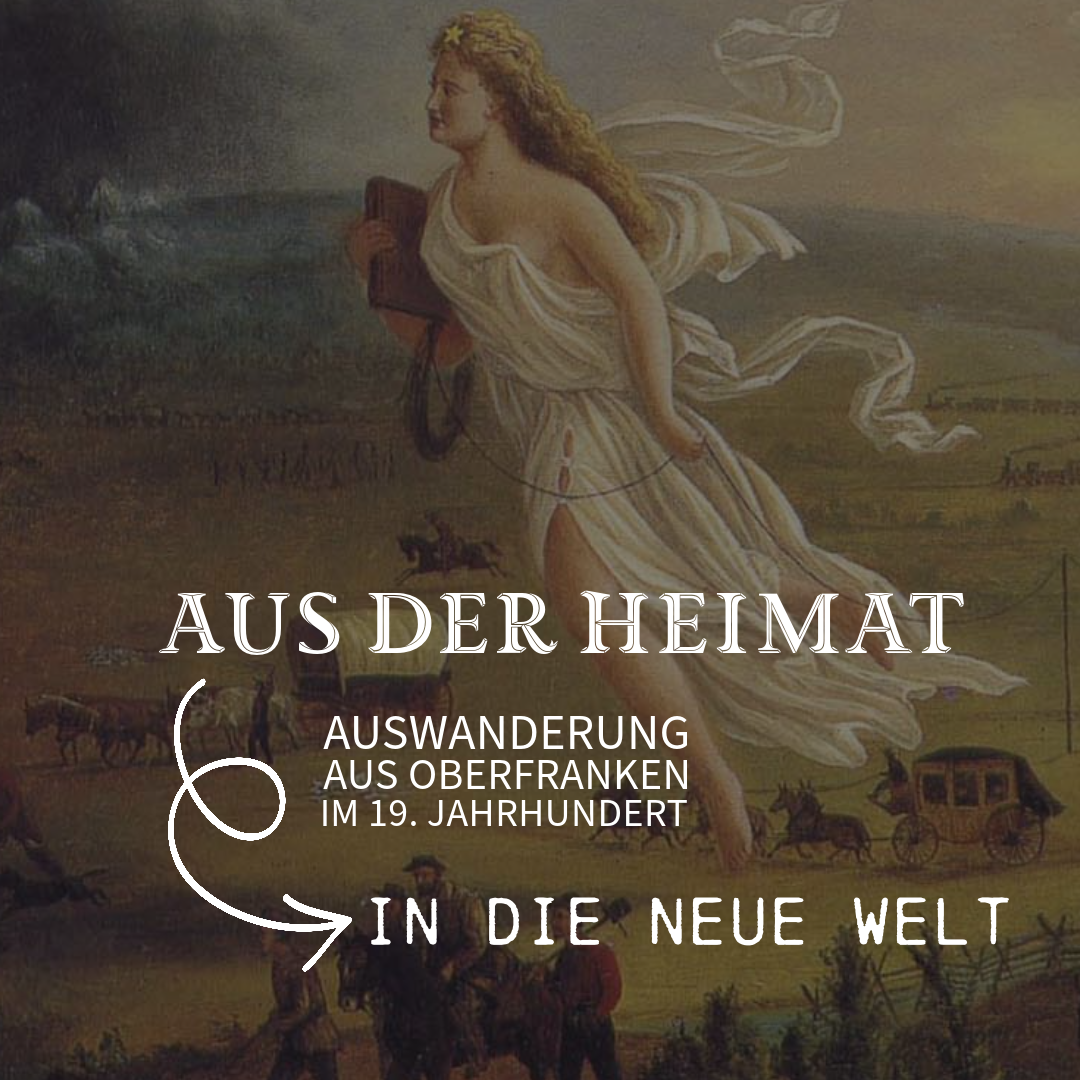
Zig verschiedene Sendungen zeigen heute die Strapazen und Vorzüge einer Auswanderung nach Amerika, doch war der Weg, den die ersten Emigranten nahmen, keinesfalls derart leicht. Verbote, falsche Agenten, Stürme und Geldnot brachten sie immer wieder an den Rand des vollständigen Ruins, obwohl sie doch eigentlich auf der Suche nach einem besseren Leben waren. Der Vortrag zeichnet den Weg der Auswanderer nach Amerika nach und beschreibt die genauen Vorgänge in einer chronologischen Abfolge.

Im 20. Jahrhundert kam mit dem Film ein komplett neues Medium auf, das uns auch heute noch in seinen Bann zieht. Anhand historischer Filmaufnahmen aus verschiedenen Sammlungen beleuchtet der Vortrag Leben und Arbeiten im Oberfranken des frühen 20. Jahrhunderts.

Johann Wolfgang Döbereiner ist nur noch eingefleischten Kennern ein Begriff, doch gilt der umgetriebene Geist dennoch bis heute als eines der größten Genies seiner Zeit: Als Erfinder des Platinfeuerzeugs und Vater eines Periodensystems der chemischen Elemente zählt er zu den Begründern der modernen Chemie. Sein Leben und seine ersten wissenschaftlichen Schritte in der Region stehen im Fokus des Vortrags.
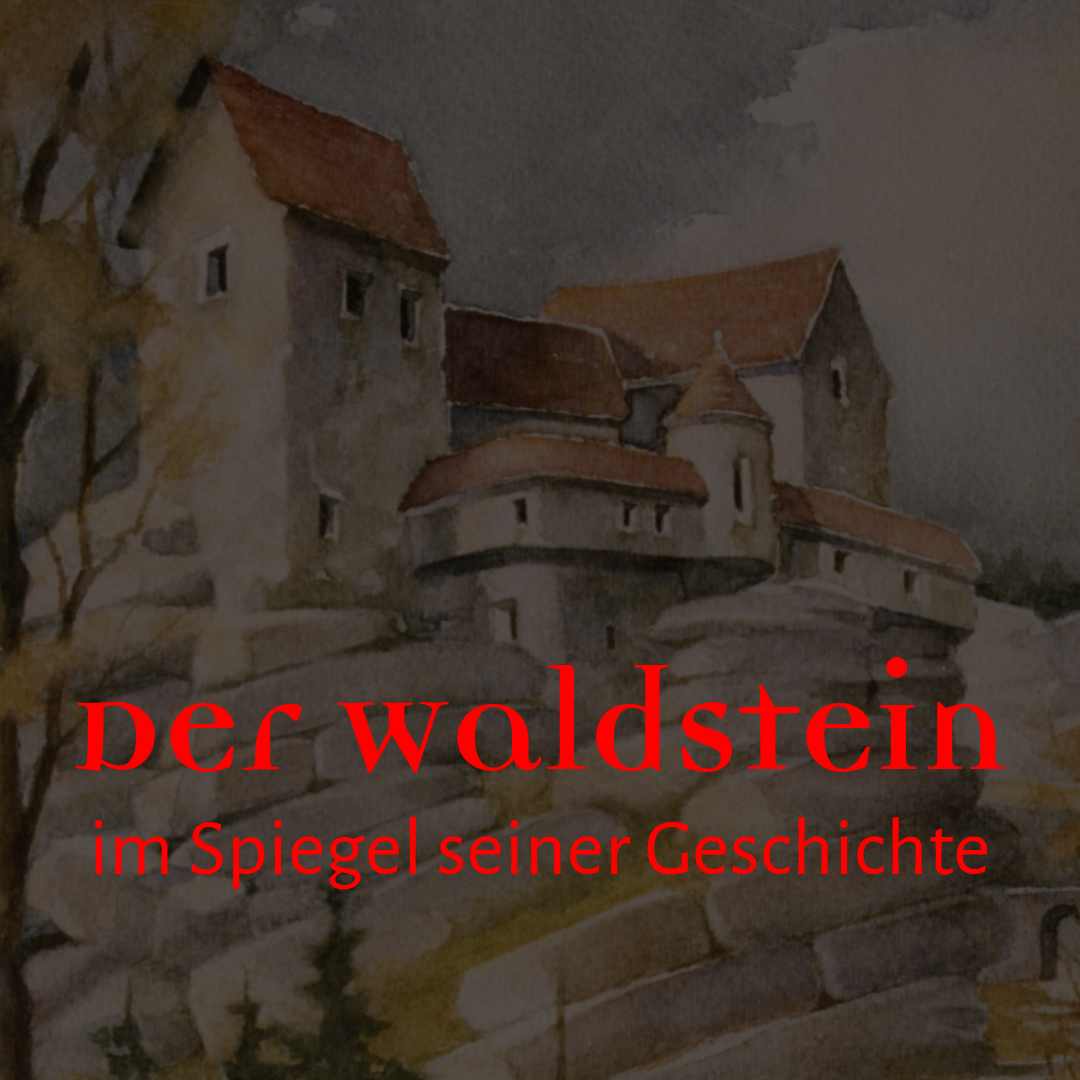
Kein anderer Berg des Fichtelgebirges hat derart viel zu bieten wie der Große Waldstein, dessen Gipfel neben der in Deutschland einzigartigen Bärenfalle auch zwei Burgen und verschiedene geologische Besonderheiten besitzt. Auf einer virtuellen Tour über den Berg werden sowohl die Geschichte als auch die Entstehung des berühmten Waldsteingranits erklärt.

Sie ist ein absolutes Kuriosum der Heimatgeschichte und heute nurmehr wenigen ein Begriff: Die Hofer Straßenbahn, die von 1901 bis 1921 in der Saalestadt verkehrte und die Bürger zum Hauptbahnhof brachte. Neben einer Betrachtung der historischen Hintergründe bietet der Vortrag eine reich bebilderte "Reise" entlang der ehemaligen Trasse, von der sich noch heute einige Relikte erhalten haben. Diesen spürt er im dritten Teil genauer nach.

Das Fichtelgebirge ist ein unglaublich vielfältiger Raum! Anhand historischer Karten spüren wir seiner Identität nach und betrachten die Auswirkungen historischer Entwicklungen.

1918 endete nicht allein der Erste Weltkrieg - mit ihm verschwand auch das imperialistische System des Deutschen Kaiserreichs im Sog der Geschichte. Mit den Worten "Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik" rief Philipp Scheidemann die erste Demokratie im Land aus, die sich direkt zu Beginn ihrer kurzen Existenz mit großen Problemen konfrontiert sah: Aufruhr und Putschversuche trugen, ebenso wie die wirtschaftlichen Krisen, dazu bei, dass die Zeit von 1918 bis 1920 als Epoche des Umsturzes und der Unsicherheit betrachtet wird. In Bayern gilt die Revolution von 1918 jedoch zudem als Geburtsstunde des modernen Freistaats, was gebührend gefeiert werden soll. Um dabei auch die eigene Heimat nicht aus den Augen zu verlieren, konzentriert sich der Vortrag auf die Geschehnisse im Fichtelgebirge - auch hier wurde geputscht und revoltiert, ehe die Unsicherheit zu teils grundlegenden Neustrukturierungen während der 1920er Jahre führte.

Viele kennen heutzutage Friedrich den Großen, König von Preußen, als Verantwortlichen für die Einführung des Kartoffelanbaus in Deutschland, doch wurden schon einhundert Jahre früher von Bauer Hans Rogler in Pilgramsreuth Kartoffeln angepflanzt, ehe der Bayreuther Markgraf Friedrich 1746 (und damit vier Jahre vor dem Preußenkönig) ihren Anbau per Dekret anordnete. Insofern ist die Knolle tatsächlich eng mit der Geschichte unserer Region verbunden, die im Mittelpunkt des Vortrages steht.
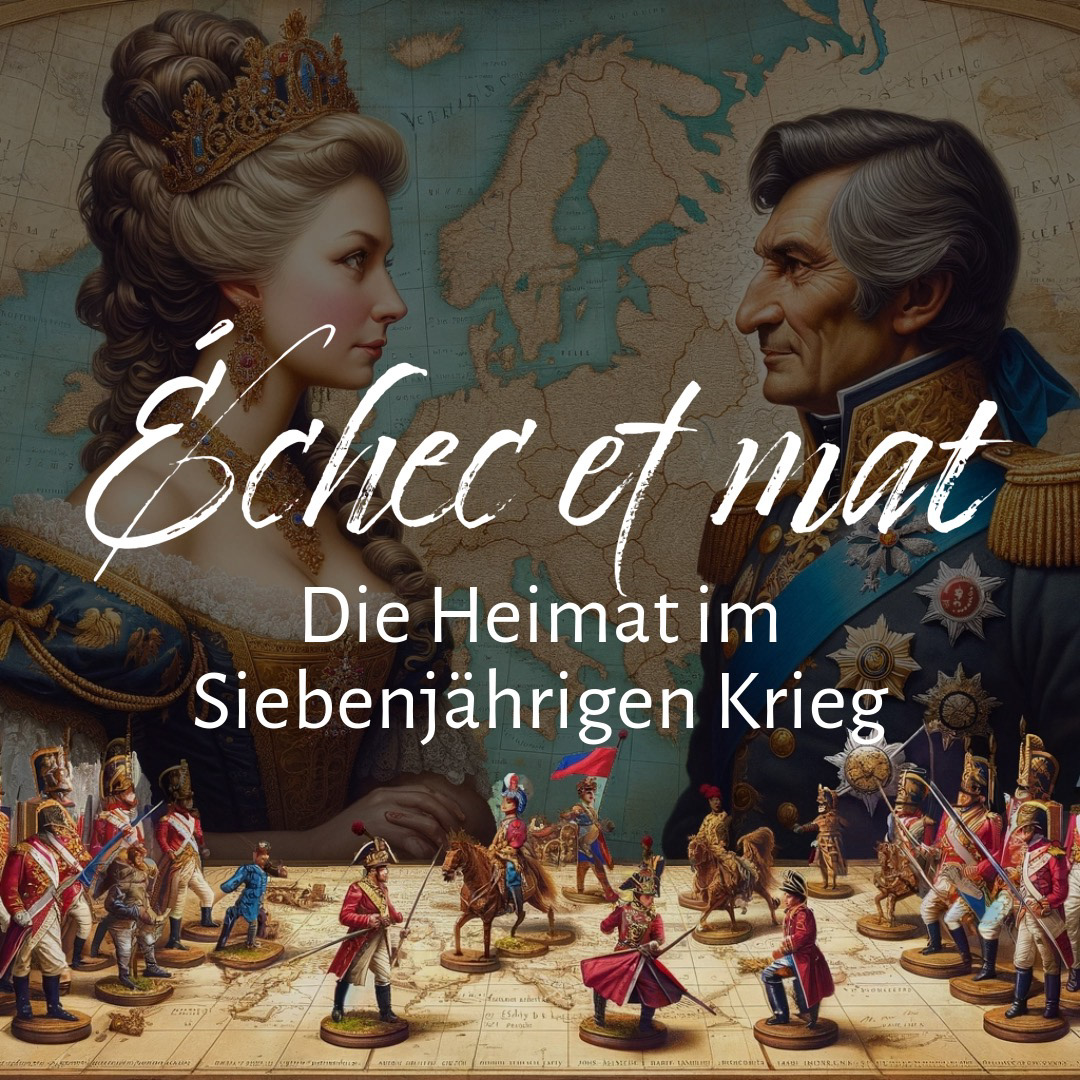
Der Kampf zwischen Preußen und den sogenannten Reichstruppen unter Führung Österreichs fand in der Heimatforschung bislang nur sehr wenig Beachtung – zu Unrecht, wenn man bedenkt, dass unsere Region gerade aufgrund der grenznahen Lage während der gesamten Zeit durch Truppendurchzüge und gigantische Heerlager in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Durch detaillierte Beschreibungen, Augenzeugenberichte und Heereskarten kann nun der genaue Ablauf der Kriegshandlungen im Hofer und Münchberger Raum nachgezeichnet werden.

Das Wissen um die heilende Wirkung des „Gottesgartens“ ist heute beinahe komplett vergessen, doch gab es im Mittelalter nicht allein jene berühmten Kundigen, wie Hildegard von Bingen, die sich mit dem Nutzen der Pflanzen auskannten, sondern auch breite, im Volksglauben verankerte Kenntnisse. Die Rolle von Kräutern u.a. bei der Heilung von Krankheiten aber auch beim Schutz gegen „das Böse“ steht ebenso im Mittelpunkt des Vortrags, wie die Suche nach den eigentlichen Ursprüngen des Aberglaubens.
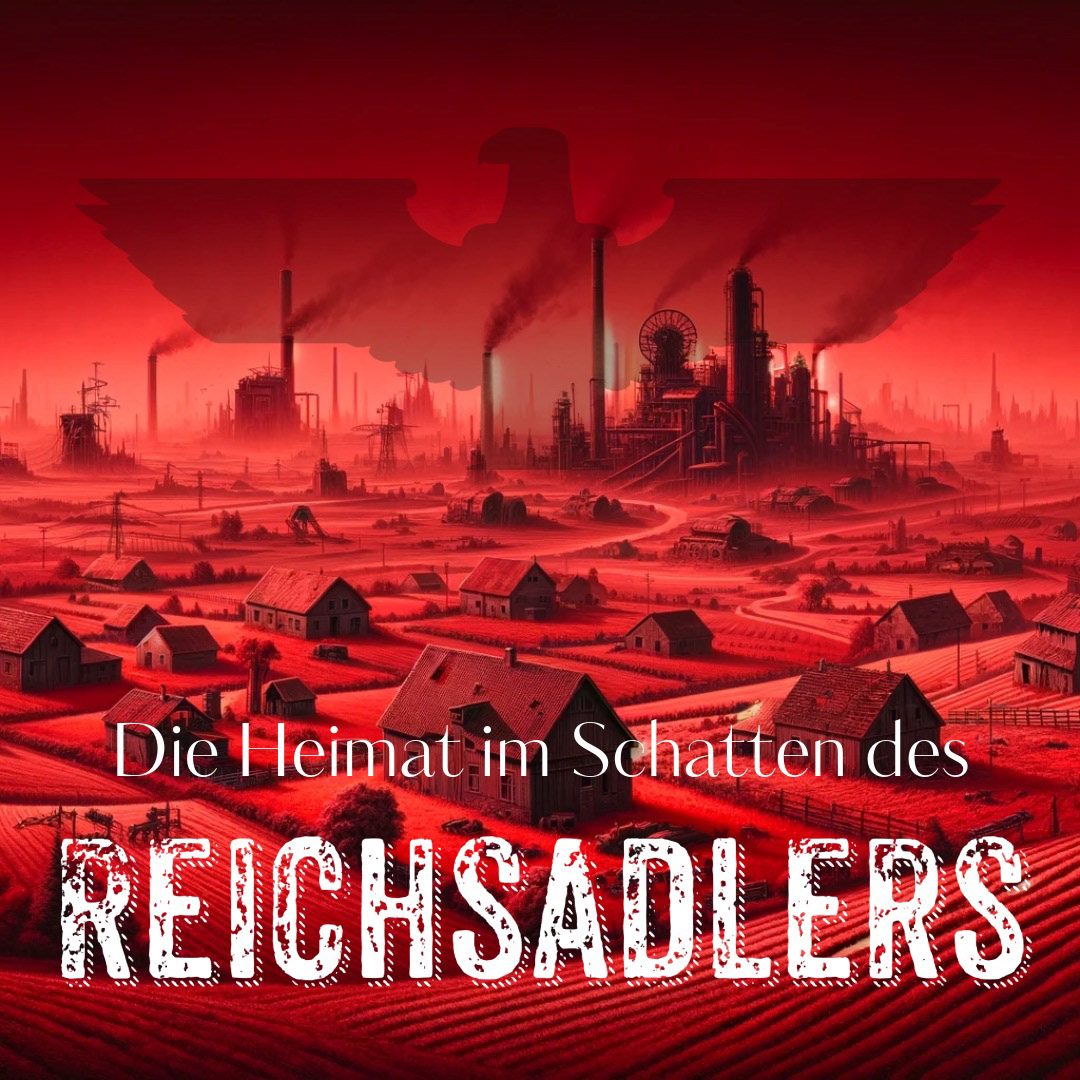
Eines der dunkelsten Kapitel unserer Geschichte hatte auch Auswirkungen auf die Heimat. Im Vortrag beleuchte ich neben der Geschichte des Nationalsozialismus auch dessen Fuß-Fassen in der Region und berichte zudem vom alltäglichen Leben mit der menschenverachtenden Ideologie der NSDAP. Anhand zahlreicher originaler Quellen wird die Heimatgeschichte von 1923 bis 1945 dargestellt.
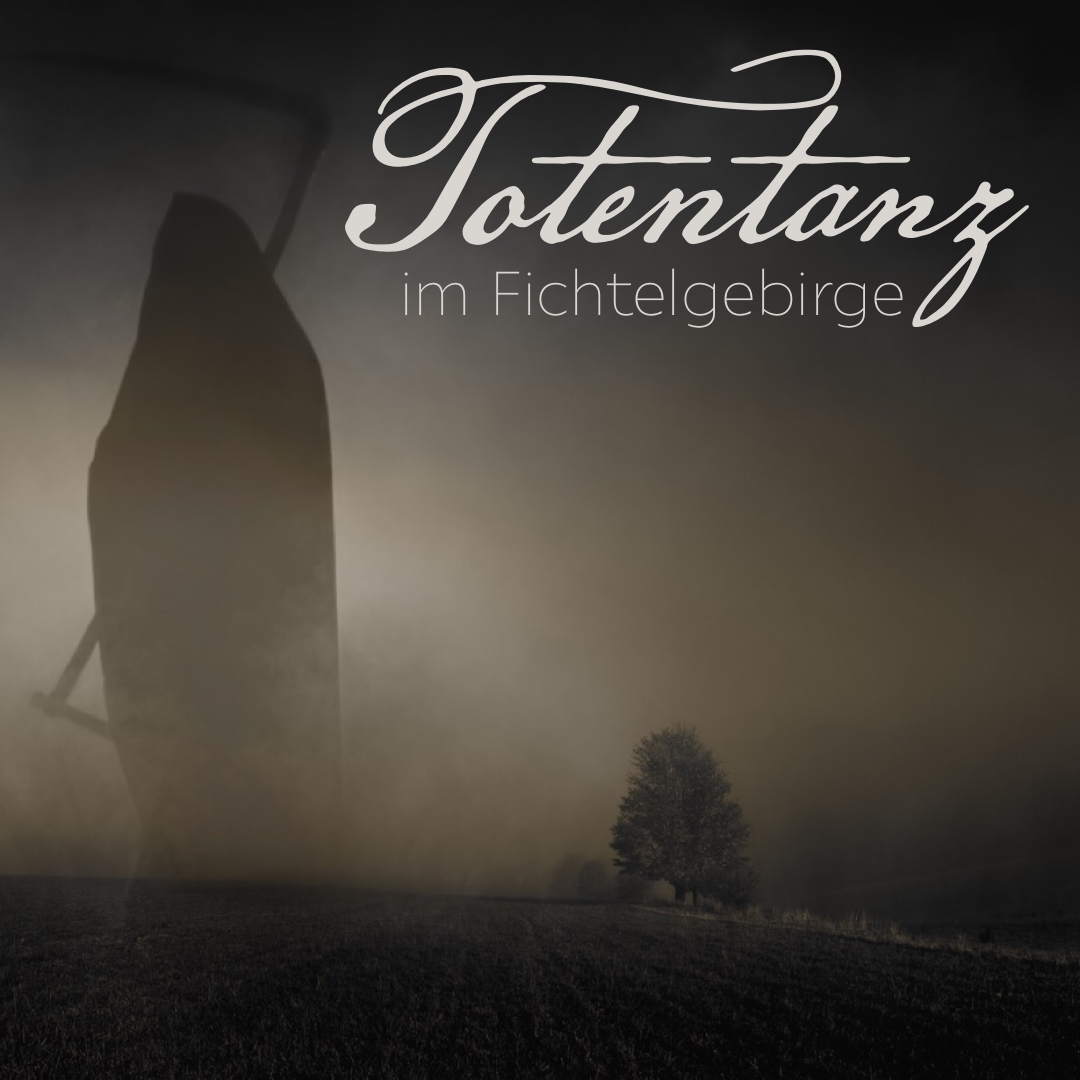
Die Pest gilt bis heute als eine der katastrophalsten Seuchen unserer Vergangenheit und forderte in ganz Europa Millionen von Opfern. Auf der Suche nach den Gründen für den Ausbruch der Krankheit schreckte man nicht davor zurück, „Andersgläubige“ zur Verantwortung zu ziehen, um damit das angebliche Strafgericht Gottes aufzuschieben. Auch im Fichtelgebirge griff in jener Zeit der Aberglauben von Neuem um sich: Pesthäuche sollten eingemauert werden, Himmelsbriefe Schutz vor den Miasmen gewähren und Bannsprüche den Tod am Betreten des Hauses hindern. Auf der Suche nach den historischen Hintergründen und den Folgen der Seuche bietet der Vortrag demnach auch eine Gesellschaftsgeschichte der Region.

Im Rahmen meiner Promotion habe ich mich fünf Jahre lang mit den Impulsen der Industrialisierung auf Wirtschaft, Infrastruktur und Gesellschaft im Münchberger Raum beschäftigt. Dabei stand im Fokus, nicht etwa weithin verbreitete Thesen zu prüfen, sondern die lokal ablaufenden Entwicklungen nachzuvollziehen, um so neue Perspektiven herauszuarbeiten: Wie lebten die Menschen in der damaligen Zeit? Gab es auch bei uns "Stürme" auf die modernen Maschinen? Welche Rolle spielten Eisenbahnen und andere Verkehrsmittel? Die Antworten auf diese Fragen und die Ergebnisse der Studie stelle ich in diesem Vortrag erstmals vor.
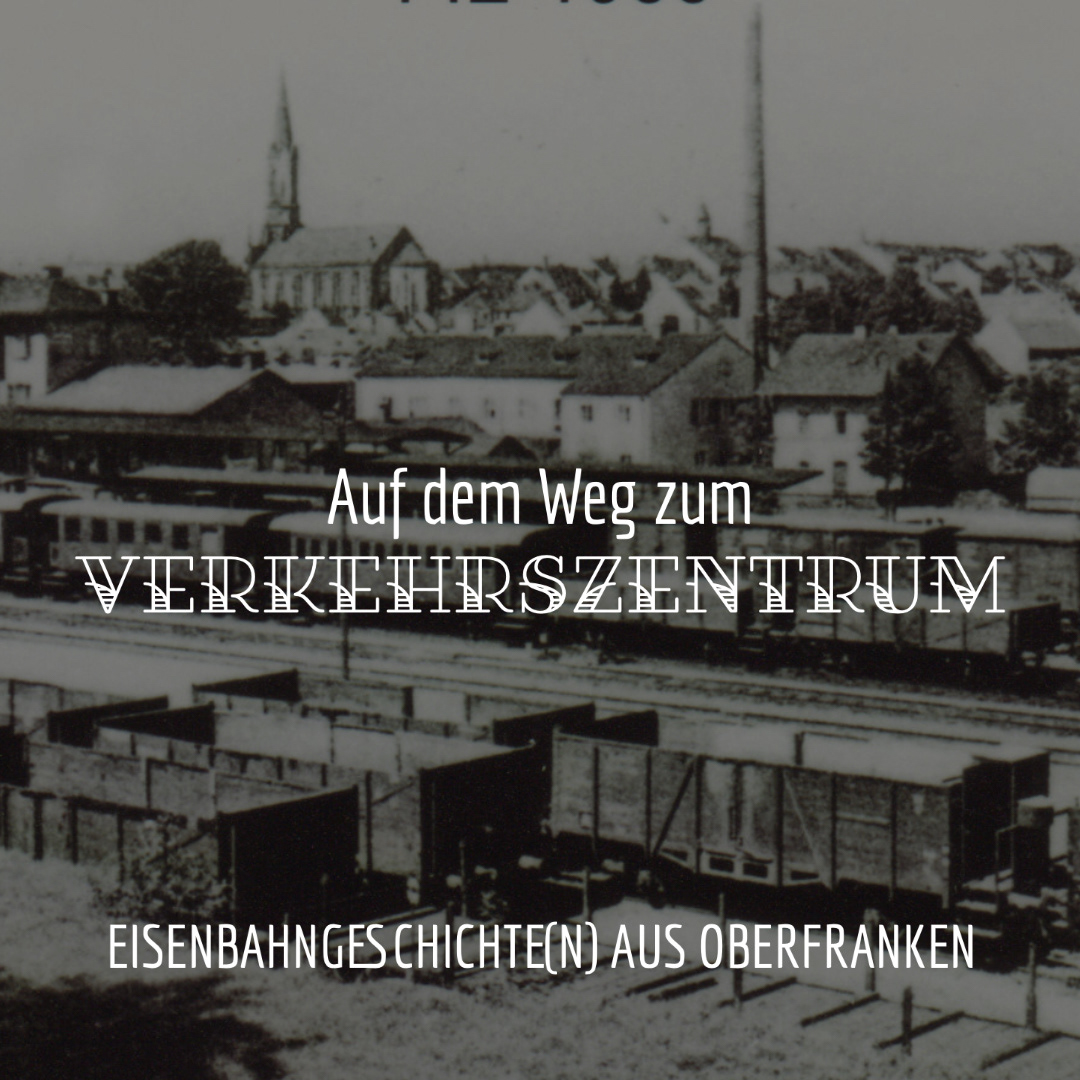
Im 19. Jahrhundert wurde der Hofer Raum zum mächtigen und wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Bereits kurz nach dem Bau der Ludwig-Süd-Nord-Bahn 1848 wollte man die angrenzenden Räume durch gigantische Streckenprojekt erschließen, aus denen letzten Endes die unzähligen Lokalbahnen entstanden sind, die die Region durchzogen. Wir werfen nicht allein einen Blick in die Geschichte, sondern schauen uns gemeinsam auch einmalige Filmaufnahmen zur Eisenbahngeschichte Nordostoberfrankens aus verschiedenen Privatsammlungen an, die im Rahmen dieses Vortrags erstmals öffentlich präsentiert werden.
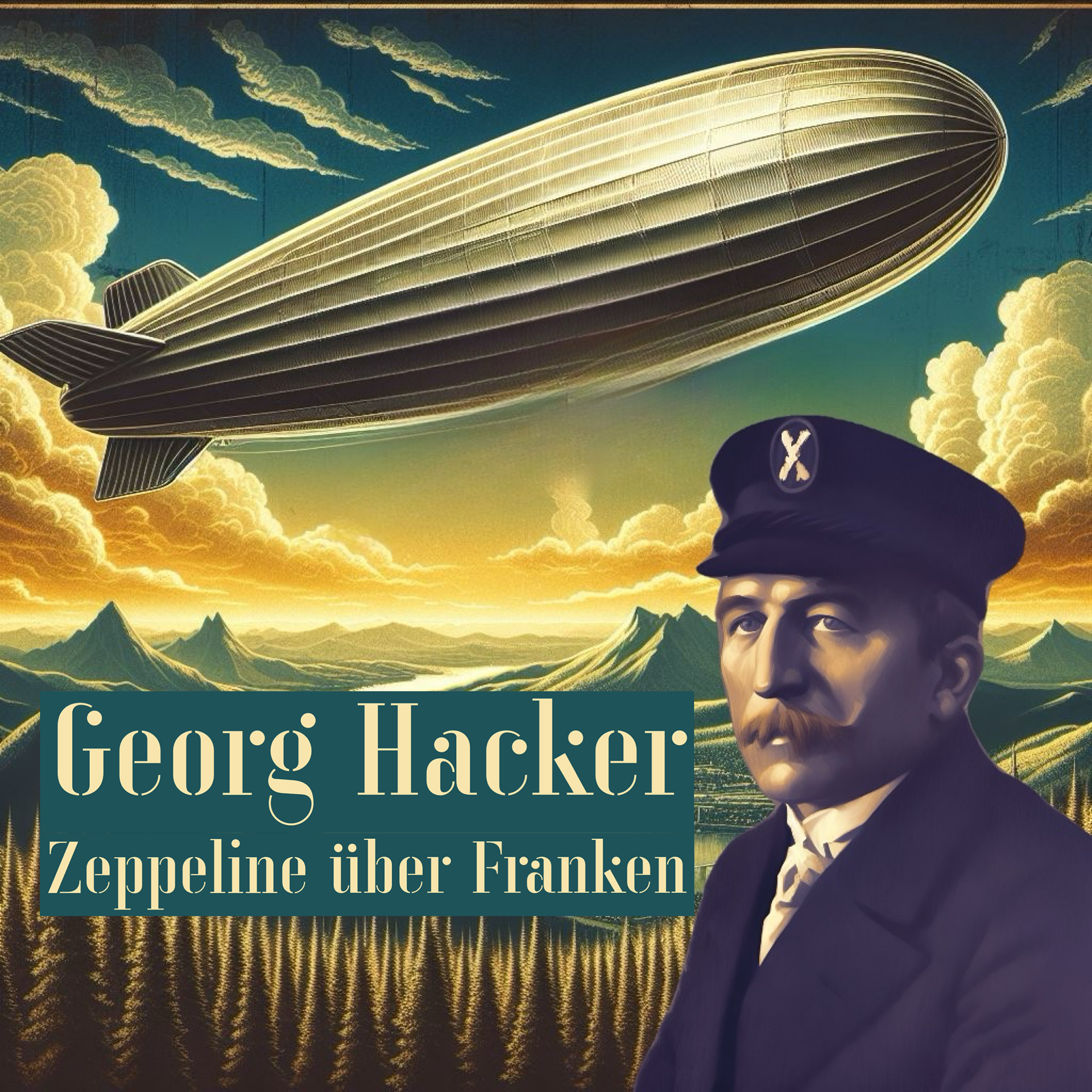
Der aus Münchberg stammende und in Hof aufgewachsene Georg Hacker ist noch heute neben dem Grafen von Zeppelin und Hugo Eckener einer der wichtigsten Pioniere der Luftschifffahrt in Deutschland. Als erster Kapitän unter Ferdinand von Zeppelin befehligte er über lange Jahre hinweg Luftschiffe aller Bauart und war auch stark an deren Entwicklung beteiligt. Eine besondere Fahrt nach Berlin, die ihn auch über das Fichtelgebirge führte, steht neben der Biographie Hackers im Mittelpunkt des Vortrages.
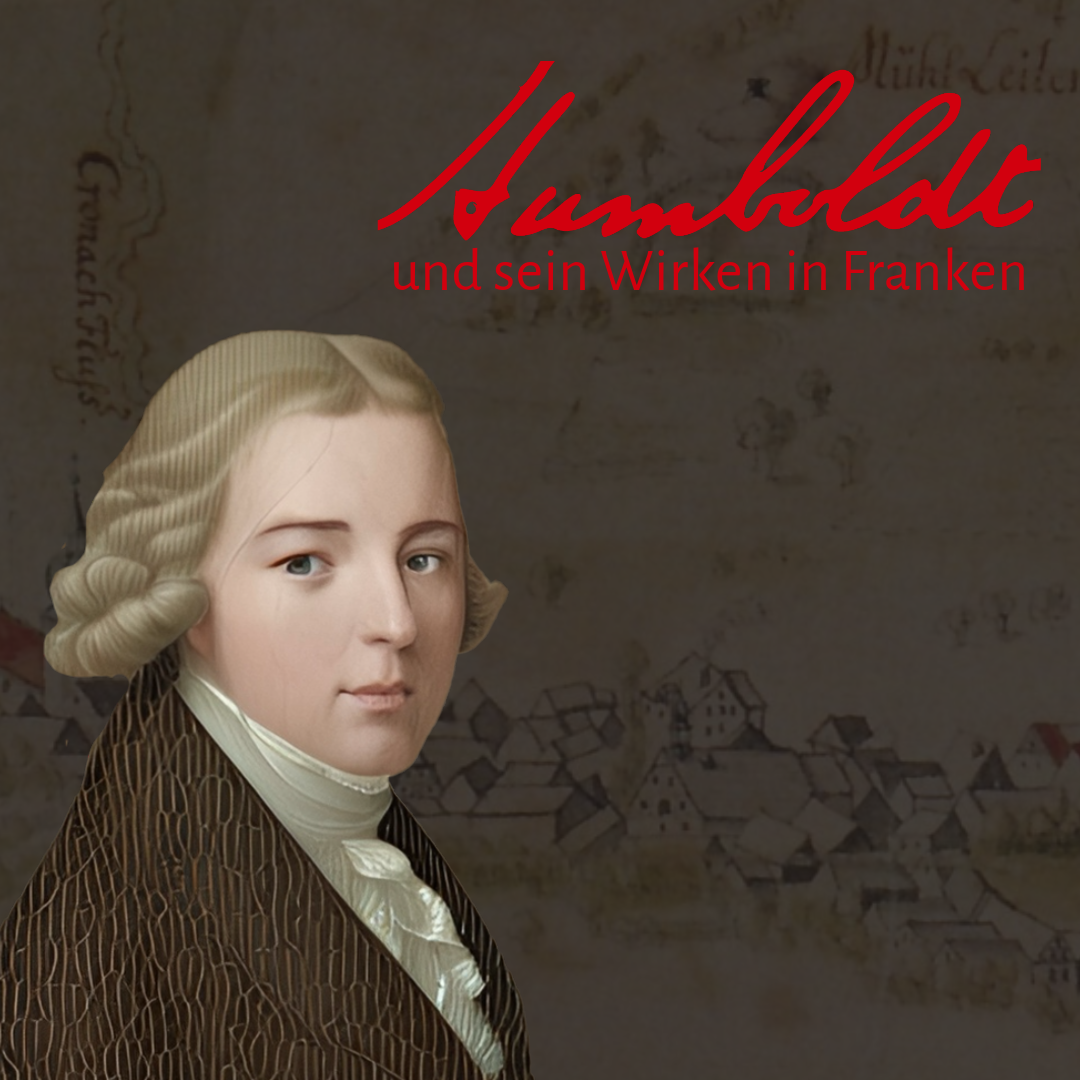
Der Fokus stellt eine spannende Verbindung zu gleich drei Jubiläen her, die 2019 gefeiert werden können: Vor 250 Jahren wird der große Universalgelehrte Alexander von Humboldt geboren, während man nahe Zell gleichzeitig damit beginnt, im Bergwerk "Hülffe Gottes" nach der seltenen Gelben Kreide zu graben. 100 Jahre später wird die aus eben dieser Grube entstandene Saalequelle in der heutigen Form gefasst. Wie genau diese drei Daten zusammenhängen, welche umfassenden und wegweisenden Studien Humboldt während seiner Zeit im Bayreuther Revier anstellte und wie er letztendlich dazu beitrug, aus der Zeche nahe der Saalequelle ein kleines "Ruhrgebiet" zu machen, wird im Vortrag anhand zahlreicher originaler Unterlagen geschildert.
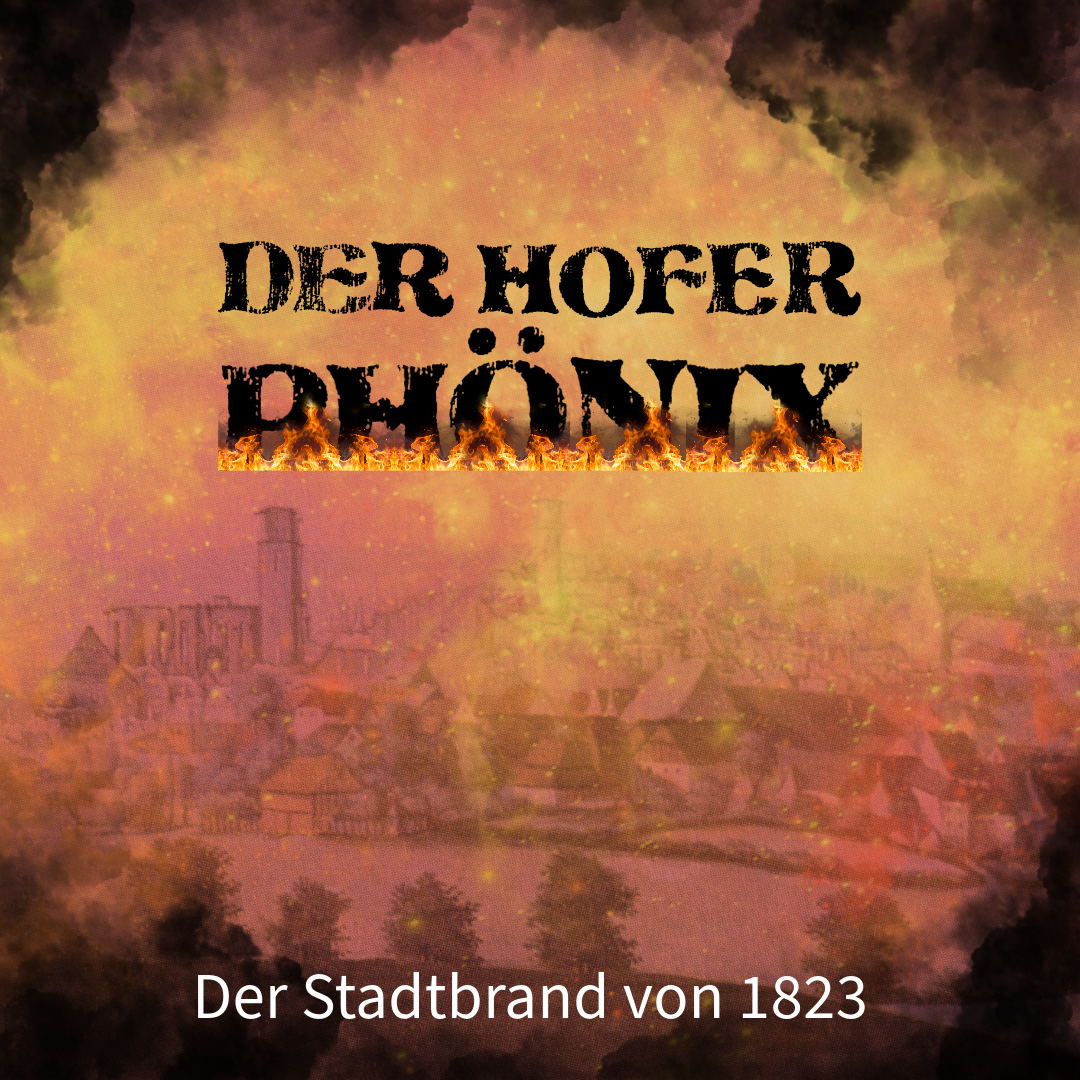
1823 brannte die Stadt Hof innerhalb kurzer Zeit vollständig ab, tausende Menschen standen von heute auf morgen vor den Trümmern ihrer Existenz. Und doch sollte sich aus der Asche schon bald Neues erheben: Eine Stadt, stolzer und schöner als jemals zuvor entstand! Die Geschichte des Brandes und des Wiederaufbaus steht im Fokus des Vortrags.

Auch wenn unsere Heimat womöglich nicht direkt in den Blick gerät, wenn man über Kolonialismus spricht, so spielten die weltweiten (wirtschaftlichen wie später politischen) Verbindungen doch auch bei uns eine elementare Rolle. Der Vortrag versucht Kontinuitäten kolonialen Denkens nachzuzeichnen und aufzuzeigen.
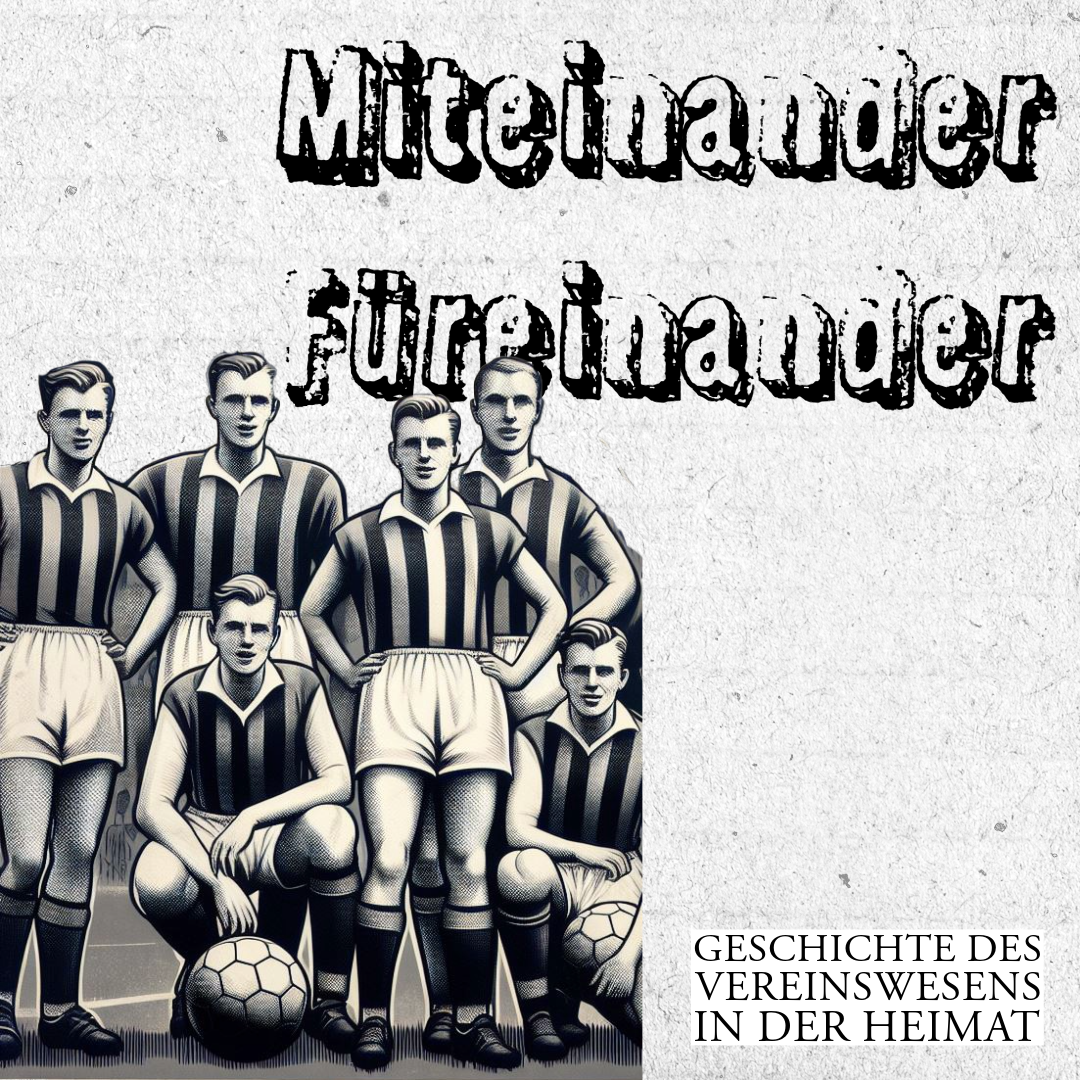
Was wäre die Gesellschaft ohne Ehrenamt und Vereine? Seit Jahrhunderten schon organisieren sich Menschen mit gleichen Interessen in Clubs und Vereinen, um sich gemeinsam für die gute Sache einzusetzen. Die Grundlagen dieser Entwicklung liegen im 19. Jahrhundert, das im Fokus des Vortrags steht: Anhand gesellschaftlicher Betrachtungen geht er so der Frage nach, wie Vereine entstehen konnten und welche Organisationen zuerst vorhanden waren.

Oberfranken gilt bis heute als "Bierland", was an der weltweit einmalig hohen Dichte von Brauereien liegt. Der Vortrag zeichnet die Anfänge des handwerklichen Brauwesens nach und erläutert die Industrialisierung anhand der Entwicklung hin zu Großbetrieben und Fabriken.

Die Industrialisierung zählt zu den einschneidendsten Ereignissen der jüngeren Geschichte: Arbeits- und Lebenswelten änderten sich grundlegend, neue Infrastrukturen entstanden und die Gesellschaft wandelte sich in vielerlei Hinsicht. Der Vortrag versucht, die verschiedenen Prozesse der Industrialisierung einzuordnen und anhand verschiedener Branchen, darunter Textil, Maschinenbau, Porzellan und Baustoffe aufzuzeigen, wie sich die Entwicklung in Oberfranken von der anderer Regionen unterschied.

Wasser schafft Leben. Aber es schuf und schafft auch Gesellschaft und Strukturen: Dieser Vortrag versucht, die Einflüsse des Wassers auf die Geschichte Frankens darzustellen und damit einen "roten Faden" in den einzelnen Linien der historischen Entwicklung nachzuzeichnen.